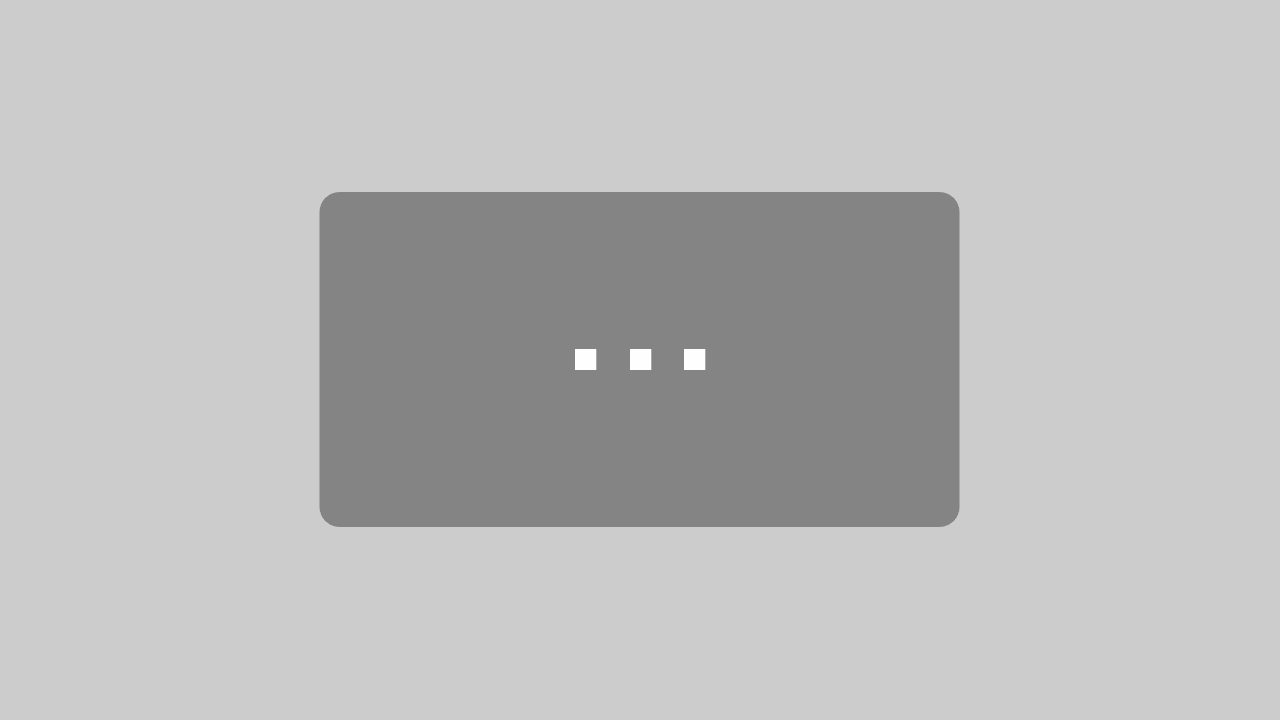Schutz vor Infektionen
Zur Prävention von Infektionen ist es entscheidend, die Übertragung von Krankheitserregern zu vermeiden. Das gilt unter anderem in der Pflege ganz besonders. Denn pflegebedürftige Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Infektionen und schwere Krankheitsverläufe. Und Pflegende können Krankheitserreger weitergeben und sich selbst infizieren. Konsequente Hygiene trägt maßgeblich zum Infektionsschutz bei.
InhaltsverzeichnisInhaltsverzeichnis minimieren
Einleitung
Wissen
- Infektion
- Anzeichen und Folgen
- Übertragungswege
- Infektionsrisiken
- Bedeutung von Hygiene
- Schutzkleidung in der Pflege
Tipps für pflegende Angehörige
Hinweise für die professionelle Pflege
Was ist eine Infektion?
Eine Infektion besteht, wenn Krankheitserreger wie Viren, Bakterien oder Pilze in den Körper gelangen und sich vermehren. Gelingt es dem Immunsystem nicht, sie abzuwehren, können sie krank machen. Dann spricht man von einer Infektionskrankheit. Infektionen können auf einzelne Stellen des Körpers begrenzt sein (Lokalinfektion). Beispiele sind Infektionen der Atemwege und der Harnwege, von Magen, Darm, Haut, Nägeln, Augen und Ohren. Sie können auch den ganzen Körper betreffen (Allgemeininfektion). Dazu gehören beispielsweise Infektionskrankheiten wie Hepatitis (Leberentzündung), Meningitis (Hirnhautentzündung) oder Sepsis (Blutvergiftung).
Wenn eine Infektion im Zusammenhang mit der professionellen Gesundheitsversorgung entsteht, spricht man von einer nosokomialen Infektion. Deutschlandweit infizieren sich auf diese Weise jährlich schätzungsweise 400.000 bis 600.000 Menschen. 80 Prozent sind Lungenentzündungen, Harnwegs- und Wundinfektionen.
Was sind mögliche Anzeichen und Folgen einer Infektion?
Je nach Infektion können unterschiedliche Symptome auftreten. Mögliche Anzeichen einer Infektion sind zum Beispiel:
- Unwohlsein, Kreislaufprobleme
- Schmerzen
- Fieber, Schüttelfrost
- Brennen beim Wasserlassen, trüber Urin, häufiger Harndrang
- Husten, Schnupfen, Atemprobleme
- Übelkeit, Erbrechen, Durchfall
- gerötete, geschwollene oder warme Hautstellen, eitrige Wunden
Bei älteren pflegebedürftigen Menschen sind die Symptome mitunter untypisch. Dadurch wird eine Infektion eventuell spät erkannt und behandelt. Dies kann sich negativ auf den Krankheitsverlauf auswirken.
Infektionen können sich verstärken, ausbreiten und Folgeerkrankungen verursachen. Zum Beispiel kann aus einer in der Regel harmlosen Infektion der oberen Atemwege eine Lungenentzündung entstehen. Erreger einer infizierten Wunde können sich im Körper ausbreiten. Eine Blasenentzündung kann zu einer Nieren-Becken-Entzündung werden.
Eine lebensbedrohliche Folge einer Infektion kann eine Sepsis sein, auch Blutvergiftung genannt. Sie ist ein Notfall. Daher ist es wichtig, sie schnell zu erkennen und zu behandeln. Informationen bietet das Aktionsbündnis Patientensicherheit (APS).
Weitere Informationen
- Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): Krankheitsbilder
- Stiftung Gesundheitswissen (SGW): Erkältung oder Grippe?, COVID-19, Lungenentzündung, Was ist eine Entzündung?
Wie werden Krankheitserreger übertragen?
Krankheitserreger können sich überall in unserer Umwelt befinden, etwa im Atem, in KörpersekretenKörpersekrete sind zum Beispiel: Blut, Speichel, Urin, Stuhl, Schweiß oder Tränen., auf Gegenständen, Textilien oder Lebensmitteln. Sie können zum Beispiel über Schleimhäute, Atemwege und Wunden in den Körper gelangen. Zudem sind künstliche Zugänge wie Blasenkatheter und Ernährungssonden mögliche Eintrittsstellen für Krankheitserreger.
Manche Erreger werden direkt von Mensch zu Mensch übertragen. Das geschieht zum Beispiel durch infektiöse Tröpfchen oder winzige Flüssigkeitspartikel (Aerosole), die beim Atmen, Sprechen, Niesen oder Husten ausgeschieden werden (Tröpfcheninfektion oder aerogene Infektion). Eine Übertragung kann aber auch durch Kontakt zu etwas erfolgen, auf dem sich Erreger befinden (Kontaktinfektion). Dabei spielen die Hände eine wesentliche Rolle, zum Beispiel beim Händeschütteln oder beim Anfassen von Gegenständen wie Türklinken. Zudem kann die gemeinsame Benutzung von Toilettenartikeln wie Zahnbürste oder Nagelfeile dazu führen, dass sich Erreger verbreiten. Auch infizierte Personen, die keine Symptome haben, können andere anstecken.
Der ZQP-Erklärfilm zeigt in knapp 2 Minuten, warum eine sorgfältige Händehygiene bei der Pflege wichtig ist. Darin erfahren Sie auch, wie man die Hände richtig reinigt.
Was beeinflusst das Infektionsrisiko?
Bei Kontakt mit Krankheitserregern kommt es nicht in jedem Fall zu einer Infektion: Ob eine Infektion folgt, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie dem Immunsystem, Vorerkrankungen, Impfungen, der Umgebung und den Hygienebedingungen. Zudem ist die Art der Erreger von Bedeutung: Einige Erreger sind robuster, leichter übertragbar oder ansteckender als andere.
Allgemein ist das Infektionsrisiko bei älteren pflegebedürftigen Menschen und auch bei Pflegenden erhöht. Dafür gibt es verschiedene Gründe:
Bei älteren pflegebedürftigen Menschen ist die Funktion des Immunsystems eingeschränkt. Zudem können einige Faktoren die Infektionsabwehr schwächen oder Infektionen fördern: Dazu gehören Mangelernährung und Flüssigkeitsmangel, einige chronische Erkrankungen sowie bestimmte Medikamente, chronische Wunden, Inkontinenz und künstliche Zugänge. Eine flache Atmung, etwa durch Schmerzen oder Bettlägerigkeit, begünstigt Atemwegsinfekte. Kommen verschiedene Faktoren zusammen, erhöht sich das Risiko für einen schweren Krankheitsverlauf.
Studien zeigen, dass ältere Menschen häufiger bestimmte Infektionskrankheiten haben als jüngere. Dazu gehören zum Beispiel Harnwegsinfekte, Lungenentzündungen oder Hautinfektionen. Außerdem besteht ein erhöhtes Risiko für Infektionen mit multiresistenten Erregern (MRE). Meistens handelt es sich dabei um Bakterien, die unempfindlich (resistent) gegen mehrere Antibiotika sind. Die Behandlung ist dadurch eingeschränkt. Ältere pflegebedürftige Menschen sind gefährdet, schwer an diesen Infektionen zu erkranken.
Zudem beeinflussen die Umstände das Infektionsrisiko: Zum Beispiel versorgen professionell Pflegende meist mehrere pflegebedürftige Menschen und können dabei Krankheitserreger übertragen. In Pflegeheimen können sich Bewohnerinnen und Bewohner auch untereinander anstecken.
Durch den engen Kontakt bei der Pflege können Pflegende mit Krankheitserregern in Berührung kommen und sich anstecken. Daher ist Hygiene auch für die Gesundheit Pflegender wichtig. Laut Daten der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) sind Infektionen die zweithäufigste gemeldete Berufskrankheit im Gesundheitswesen. Wie viele pflegende Angehörige sich im Pflegealltag infizieren, lässt sich schwer ermitteln und ist nicht bekannt.
Weitere Informationen
Stiftung Gesundheitswissen (SGW): Informationen zur Funktionsweise von Immunsystem und Impfungen sowie zu unterschiedlichen Krankheitserregern
Welche Bedeutung hat Hygiene für den Schutz vor Infektionen?
Konsequente Hygiene trägt maßgeblich dazu bei, die Übertragung von Krankheitserregern zu verhindern. Das gilt allgemein im Alltag und ist besonders bedeutsam in der Medizin und der Pflege. Entscheidend hierbei ist zum einen das individuelle Hygieneverhalten wie zum Beispiel die Händereinigung. Zum anderen sind die Hygienebedingungen wichtig. Dazu gehören zum Beispiel Möglichkeiten zur Reinigung der Hände und die Ausstattung mit Hilfsmitteln wie Desinfektionsmittel oder Schutzkleidung.
- Hygiene im Alltag
-
Im Alltag bedeutet Hygiene vor allem, sich regelmäßig und gründlich die Hände zu reinigen und sich beim Husten oder Niesen von anderen abzuwenden. Dazu gehört auch, den Haushalt sauber zu halten. Desinfektionsmittel sind im privaten Haushalt in der Regel nicht nötig. Sie können sogar schädlich sein, indem sie Allergien oder Hautschäden verursachen und Krankheitserreger unempfindlich machen (Resistenz-Bildung).
- Hygiene bei der Pflege
-
Bei der Versorgung pflegebedürftiger Menschen sind je nach Situation weitergehende Hygienemaßnahmen nötig. Dazu gehören insbesondere die konsequente und gründliche Händehygiene vor und nach jeder Pflegemaßnahme sowie die Hygiene beim Umgang mit eventuell infektiösen Materialien. Bestimmte Erreger wie Multiresistente Erreger (MRE) oder das Corona-Virus erfordern darüber hinaus spezielle Hygienemaßnahmen, etwa die Verwendung von Schutzkleidung. Ob und welche Schutzkleidung getragen werden muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Bedeutsam ist beispielsweise, wie ein Erreger übertragen werden könnte und ob eine Person gefährdet ist, schwer zu erkranken. Zudem ist es relevant, ob es Medikamente oder eine Schutzimpfung gegen die Infektion mit dem Erreger gibt.
Regelungen und Herausforderungen in der professionellen Pflege
Für die professionelle Pflege gibt es eine Reihe gesetzlicher Vorgaben zu Hygienemaßnahmen. Standards, Leitlinien und Empfehlungen bieten eine fachliche Orientierung. Außerdem gibt es einrichtungsinterne Regelungen zu Hygienemaßnahmen. Das betrifft zum Beispiel die Händehygiene, die Wundversorgung sowie den hygienischen Umgang mit Medikamenten und künstlichen Zugängen. Deren Einhaltung ist unter anderem Gegenstand der Qualitätsprüfungen vom Medizinischen Dienst (MD) und Prüfdienst der Privaten Krankenversicherung (Careproof). Mangelnde Hygiene ist ein relevantes Problem für die Sicherheit pflegebedürftiger Menschen. Das gilt insbesondere für die Händehygiene. Diese ist hoch bedeutsam zur Infektionsprävention. Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) kann die richtige Händehygiene im Gesundheitswesen das Risiko, Krankheitserreger zu übertragen, um 50 Prozent reduzieren. Für Deutschland wird davon ausgegangen, dass 20 bis 30 Prozent der nosokomialen Infektionen vermeidbar wären, wenn Hygienemaßnahmen korrekt eingehalten werden würden.
Bei der Umsetzung der richtigen Händehygiene besteht in der professionellen Pflege Verbesserungsbedarf. Hierauf weist unter anderem eine ZQP-Studie aus dem Jahr 2020 unter Pflegedienstleitungen und Qualitätsbeauftragten von 535 ambulanten Pflegediensten hin. Diese wurden nach dem Vorkommen von Fehlern gefragt, die in den letzten sechs Monaten mindestens einmal in dem Dienst aufgetreten waren. 31 Prozent gaben hierbei die Händehygiene an.
Informationen zu Herausforderungen in der ambulanten Pflege
Wozu dient Schutzkleidung in der Pflege?
Schutzkleidung soll dazu beitragen, die Übertragung von Krankheitserregern bei der Pflege zu verhindern. Je nach Situation dient sie dem Selbstschutz, dem Fremdschutz oder beidem. Schutzkleidung in der professionellen Gesundheitsversorgung unterliegt verschiedenen gesetzlichen Anforderungen. Festgelegt ist unter anderem, wie reißfest oder dicht sie sein muss. Angewendet werden zum Beispiel:
Tipps für pflegende Angehörige
Infektionen vorbeugen
Ältere pflegebedürftige Menschen haben ein erhöhtes Risiko für Infektionen. Zudem können Infektionen gerade bei ihnen mit schwerwiegenden Komplikationen einhergehen. Pflegende können Krankheitserreger weitergeben und sich selbst infizieren.
Hygienemaßnahmen tragen dazu bei, Infektionen vorzubeugen – bei pflegebedürftigen Menschen und bei Pflegenden.
- Hygiene bei der Pflege einhalten
-
Durch den engen Kontakt bei der Pflege können Krankheitserreger auf pflegebedürftige Menschen übertragen werden. Das gilt für alle Pflegemaßnahmen, besonders aber bei körpernahen Tätigkeiten wie der Mundpflege oder der Wundversorgung.
- Achten Sie auf eine gründliche Händehygiene. Fassen Sie sich möglichst nicht ins Gesicht.
- Husten oder niesen Sie in ein Einmal-Taschentuch oder in die Armbeuge. Drehen Sie sich dabei weg. Lüften Sie mehrmals täglich.
- Regen Sie auch die pflegebedürftige Person dazu an, Hygieneregeln einzuhalten.
- Pausieren Sie die Pflege möglichst, wenn Sie Anzeichen einer Infektion haben. Bitten Sie in dieser Zeit andere um Hilfe. Oder nutzen Sie Unterstützungsangebote für pflegende Angehörige.
- Verwenden Sie bei der Pflege saubere und intakte Materialien. Das gilt zum Beispiel für Einmal-Handschuhe.
- Nutzen Sie Einmal-Produkte nicht mehrmals.
- Packen Sie steriles Material direkt vor dem Gebrauch mit gereinigten Händen aus, zum Beispiel Injektionsnadeln oder Wundauflagen. Fragen Sie Fachleute, wie Sie mit sterilen Materialien richtig umgehen.
- Desinfizieren Sie die Haut vor Punktionen und Injektionen, zum Beispiel vor der Blutzuckermessung und Insulingabe.
- Tragen Sie bei der Pflege möglichst keine langen Ärmel. Legen Sie Schmuck an den Händen und Unterarmen ab. Binden Sie lange Haare zusammen.
- Beseitigen Sie Körpersekrete sofort. Säubern Sie alles gründlich, was damit in Kontakt gekommen ist. Tragen Sie dabei medizinische Einmal-Handschuhe. Reinigen Sie danach Ihre Hände.
- Entsorgen Sie eventuell infektiöse Einmal-Materialien in einem verschlossenen Behältnis, zum Beispiel in einer Tüte im Hausmüll. Dazu gehören zum Beispiel Taschentücher, Inkontinenzmaterial, Verbände und Kompressen. Spitze oder scharfe Gegenstände wie Injektionsnadeln sollten in speziellen Behältern entsorgt werden, die durchstich-sicher sind. Setzen Sie die Verschlusskappe nicht wieder auf. Sie könnten sich dabei verletzen.
- Achten Sie bei der Medikamentengabe auf Hygiene. Weitere Informationen erhalten Sie bei den Tipps zum Umgang mit Medikamenten.
- Lassen Sie sich von Fachleuten anleiten, wie spezielle Hilfsmittel richtig gereinigt werden, zum Beispiel Mundstücke von Inhalationsgeräten.
- Halten Sie die Hygieneregeln bei der Köperpflege ein. Mehr dazu erfahren Sie bei den Tipps gegen Hautprobleme.
- Nutzen Sie Toilettenartikel nicht gemeinsam, etwa Zahnbürste, Nagelfeile, Rasierer oder Creme in Dosen. Gleiches gilt für Waschlappen, Handtücher, Geschirr und Besteck. Weitere allgemeine Hygienetipps bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA): infektionsschutz.de.
- Hände richtig reinigen
-
Viele Infektionskrankheiten werden hauptsächlich über die Hände übertragen. Die regelmäßige und gründliche Reinigung der Hände gehört daher im Pflegealltag zu den wichtigsten Hygienemaßnahmen.
- Waschen Sie Ihre Hände mehrmals täglich. Gewöhnen Sie sich an, dies immer in bestimmten Situationen zu tun, etwa wenn Sie die Wohnung betreten. Bei sichtbaren oder spürbaren Verschmutzungen sollten Sie sich die Hände in jedem Fall waschen. Desinfizieren Sie die Hände bevorzugt, wenn die Händehygiene besonders oft erfolgen muss, etwa bei Infektionen. Das ist schonender für die Haut.
- Entfernen Sie Schmuck an den Händen, bevor Sie Ihre Hände waschen oder desinfizieren. Sonst könnten sich Feuchtigkeit und Erreger darunter stauen.
- Reinigen Sie Ihre Hände vor jeder Pflegemaßnahme sowie Kontakt mit Schleimhäuten, Hautverletzungen oder sterilen Materialien. Das gilt auch vor dem Umgang mit Lebensmitteln, Medikamenten, Hygieneartikeln und Schutzkleidung. Reinigen Sie sich auch die Hände, bevor Sie Handschuhe anziehen.
- Reinigen Sie Ihre Hände nach jeder Pflegemaßnahme sowie Kontakt mit infizierten Körperstellen, Wunden, Schleimhäuten oder Körpersekreten. Das gilt auch, wenn Sie Handschuhe getragen haben. Reinigen Sie Ihre Hände auch, nachdem Sie etwas anderes angefasst haben, worauf sich Krankheitserreger befinden könnten. Dazu gehören zum Beispiel: Toilette, Abfall, rohes Fleisch, Tiere, Geld, Türklinken und Schutzkleidung.
- Holen Sie bei Hautproblemen ärztlichen Rat ein. Wenn die Hände beispielsweise wegen gereizter Haut nicht ausreichend gereinigt werden, können Erreger leichter übertragen werden. Außerdem ist gereizte Haut anfälliger für Infektionen. Mehr zur hautschonenden Reinigung und Pflege der Hände erfahren Sie bei den Tipps zur Handpflege für Pflegende.
Hände richtig waschen
- Halten Sie Ihre Hände unter fließendes Wasser.
- Seifen Sie diese für 20 bis 30 Sekunden vollständig ein: Handflächen, zwischen den Fingern, Fingerspitzen, Nägel, Daumen und Handrücken. Verwenden Sie seifenfreie Waschlotion. Seifenstücke sind weniger hygienisch.
- Spülen Sie Ihre Hände gründlich unter fließendem Wasser ab.
- Trocknen Sie Ihre Hände sorgfältig ab, auch zwischen den Fingern. Verwenden Sie ein sauberes und trockenes Handtuch.
Hände richtig desinfizieren
- Verwenden Sie flüssiges Hände-Desinfektionsmittel, am besten auf Alkoholbasis.
- Halten Sie die Anwendungshinweise ein, etwa zu Einsatzbereichen, zur Einwirkzeit und zur Menge.
- Tragen Sie das Desinfektionsmittel auf trockene, saubere Hände auf.
- Verteilen Sie die Flüssigkeit großzügig auf der ganzen Hand, inklusive Finger und Nägel.
- Hygiene im Haushalt beachten
-
Erreger können sich unter anderem auf Oberflächen, Gegenständen und Textilien befinden. Wenn diese von mehreren Personen benutzt oder angefasst werden, können dabei Erreger übertragen werden (Kontaktinfektion).
- Reinigen Sie häufig genutzte Flächen und Gegenstände regelmäßig mit Haushaltsreiniger. Dazu gehören zum Beispiel Spüle, Toilette, Haltegriffe, Türklinken, Lichtschalter, Nachttisch. Verwenden Sie für Küche, Bad und Toilette unterschiedliche Putzlappen. Hängen Sie diese anschließend zum Trocknen auf.
- Waschen Sie Geschirr gründlich und möglichst heiß ab. Wenn möglich nutzen Sie die Spülmaschine. Wenn Anzeichen einer Infektion bestehen, wählen Sie ein Spülprogramm bei mindestens 60°C.
- Wechseln Sie Bettwäsche mindestens alle 2 Wochen. Bei bettlägerigen Menschen sollte die Bettwäsche mindestens 1-mal pro Woche gewechselt werden. Handtücher sollten 2-mal pro Woche, Waschlappen und Unterwäsche täglich ausgetauscht werden. Verschmutzte Wäsche, Kleidung und Handtücher sollten direkt ausgetauscht werden.
- Waschen Sie mit Körpersekret verschmutzte Textilien möglichst bei hoher Temperatur. Textilien von ansteckend erkrankten Personen sollten separat gewaschen werden, wenn möglich bei mindestens 60°C. Bei Infektionen ist bleichhaltiges Vollwaschmittel ratsam.
- Verwenden Sie Desinfektionsmittel für Flächen oder die Wäsche nicht routinemäßig. Holen Sie vorher fachlichen Rat ein, ob dies erforderlich ist.
Weitere Informationen zum Thema Haushaltshygiene bietet die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).
- Mit Lebensmitteln hygienisch umgehen
-
Infektionen können auch durch Erreger auf oder in Lebensmitteln verursacht werden. Diese können zum Beispiel zu Erbrechen oder Durchfall und mitunter zu schweren Gesundheitsproblemen führen.
- Waschen Sie sich die Hände, bevor Sie Essen zubereiten und anreichen – und danach.
- Achten Sie auf Hygiene in der Küche, zum Beispiel: Verwenden Sie sauberes Besteck und Geschirr. Säubern Sie die Arbeitsflächen, bevor Sie Lebensmittel darauf zubereiten. Reinigen Sie besonders gründlich, was mit rohem Fleisch, Fisch und Ei in Kontakt kam. Nutzen Sie ein sauberes und trockenes Geschirrhandtuch. In feuchten Textilien können sich Erreger gut vermehren. Verwenden Sie nicht das gleiche Handtuch für die Hände.
- Verbrauchen Sie frische Lebensmittel rasch, insbesondere rohes Fleisch und Fisch. Bei langer oder falscher Lagerung können sich Erreger leicht vermehren.
- Prüfen Sie Geruch, Aussehen und Haltbarkeitsdatum, bevor Sie Lebensmittel zubereiten oder bereitstellen.
- Waschen Sie Obst und Gemüse gründlich ab – auch wenn Sie es schälen.
- Bereiten Sie Tee mit kochendem Wasser zu.
- Erhitzen Sie Speisen beim Kochen und beim erneuten Aufwärmen vollständig. Das gilt besonders für tierische Produkte.
- Bewahren Sie leicht verderbliche Lebensmittel im Kühlschrank auf. Die Kühlung sollte nur so kurz wie unbedingt nötig unterbrochen werden.
- Stellen Sie Speisen erst kurz vor dem Verzehr bereit. Lassen Sie zum Beispiel Joghurt nicht stundenlang auf dem Nachttisch stehen. Entsorgen Sie abgestandene Getränke.
Weitere Informationen zum Schutz vor Lebensmittelinfektionen bietet das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR). Auf der Webseite des Bundesamts für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) erfahren Sie mehr zum Umgang mit Lebensmitteln.
- Spezielle Maßnahmen bei Problemkeimen ergreifen
-
Durch multiresistente Erreger (MRE) hervorgerufene bakterielle Infektionen können nicht oder nur eingeschränkt mit Medikamenten behandelt werden. Ältere pflegebedürftige Menschen sind gefährdet, daran schwer zu erkranken.
- Holen Sie ärztlichen Rat zu Hygienemaßnahmen ein, wenn ein multiresistenter Erreger (MRE) bei der pflegebedürftigen Person festgestellt wurde. Auch Pflegefachpersonen oder das Gesundheitsamt können beraten.
- Halten Sie sich genau an die vorgegebenen Hygiene- und Schutzmaßnahmen. Beachten Sie nach Kontakt mit der pflegebedürftigen Person oder ihrer unmittelbaren Umgebung besonders die gründliche Händehygiene. Tragen Sie wenn nötig Schutzkleidung.
- Achten Sie darauf, dass Wunden der pflegebedürftigen Person durch ein Pflaster oder einen Verband abgedeckt sind.
- Reinigen Sie Geschirr, Besteck und Wäsche möglichst sofort. Beachten Sie weitere Hinweise zur Reinigung von Haushalt und Wäsche bei Infektionen.
- Besprechen Sie das Vorgehen mit einer Pflegefachperson, der Ärztin oder dem Arzt, falls zum Infektionsschutz eine Isolation erforderlich ist. Wie Sie währenddessen die soziale Einbindung unterstützen können, zeigen die Tipps gegen soziale Isolation und Einsamkeit.
Weitere Informationen zu multiresistenten Erregern bietet das Zentrum für Qualität in der Medizin (ÄZQ). Die Stiftung Gesundheitswissen (SGW) informiert über Antibiotika und Antibiotika-Resistenzen.
- Schutzkleidung bei der Pflege tragen
-
Schutzkleidung trägt dazu bei, die Übertragung von Krankheitserregern bei der Pflege zu verhindern. Sie dient zum Selbstschutz, zum Fremdschutz oder beidem. Dazu muss Schutzkleidung richtig getragen und abgelegt werden.
- Tragen Sie medizinische Einmal-Handschuhe bei Handkontakt mit Körpersekreten und damit verschmutzten Materialien sowie bei der Mundpflege und der Körperpflege. Das gilt auch, wenn Sie Salben mit Arzneistoffen auftragen. Worauf Sie zum Schutz Ihrer Haut bei Handschuhen achten sollten, erfahren Sie bei den Tipps zur Handpflege für Pflegende.
- Verwenden Sie wenn nötig sterile Einmal-Handschuhe. Fragen Sie die Ärztin, den Arzt oder die Pflegefachperson, ob dies bei bestimmten Tätigkeiten erforderlich ist.
- Schützen Sie kleine Verletzungen an Ihren Händen, zum Beispiel durch ein Pflaster oder einen Fingerling.
- Tragen Sie einen Schutzkittel oder eine Schürze, wenn Ihre Kleidung mit Körpersekreten in Kontakt kommen könnte. Je nach Tätigkeit eignen sich langärmlige, am Rücken verschließbare oder flüssigkeitsabweisende Modelle. Achten Sie darauf, dass die Verschlussbänder fest sitzen. Ziehen Sie die Handschuhe bei langärmligen Kitteln über die Ärmel.
- Verwenden Sie eine medizinische Mund-Nasen-Maske bei Anzeichen für eine Atemwegsinfektion. Das gilt auch, wenn ein erhöhtes Ansteckungsrisiko besteht, zum Beispiel wegen einer Immunschwäche. Wichtig: Beachten Sie fachliche Empfehlungen zur Handhabung der Masken.
- Tragen Sie eine Schutzbrille, wenn Krankheitserreger in die Augen gelangen könnten. Das wäre zum Beispiel beim Absaugen von Atemwegssekreten möglich.
- Verwenden Sie nur unbeschädigte und saubere Schutzkleidung. Schützen Sie diese bei der Lagerung vor Staub und Feuchtigkeit.
- Beachten Sie die Hinweise zur Anwendung in der Produktbeschreibung.
- Verwenden Sie Einmal-Material nicht mehrfach.
Schutzkleidung richtig ablegen
- Berühren Sie beim Ablegen der Schutzkleidung möglichst nicht die Außenseite. Diese sollte auch mit nichts anderem in Kontakt kommen. Sonst könnten Erreger darauf übertragen werden.
- Ziehen Sie zuerst die Handschuhe aus. Streifen Sie die Stulpen dazu über die Hand, sodass die Innenseite außen ist.
- Stülpen Sie die Außenseite des Kittels nach innen. Verschlussbänder von Einmal-Kitteln können aufgerissen werden.
- Fassen Sie die Mund-Nasen-Maske nur an den Bändern an.
- Entsorgen Sie Einmal-Material direkt nach dem Ausziehen. Reinigen Sie wiederverwendbare Produkte wie die Schutzbrille sofort. Waschbare Schutzkleidung sollte getrennt von anderer Kleidung gelagert und gewaschen werden.
- Reinigen Sie Ihre Hände gründlich, nachdem Sie die gesamte Schutzkleidung abgelegt haben. Grundsätzlich gilt: Handschuhe ersetzen nicht die Händehygiene.
- Menschen mit Demenz unterstützen
-
Für Menschen mit Demenz wird es mit Fortschreiten der Erkrankung schwieriger, Hygieneregeln umzusetzen. Zudem kann Schutzkleidung verunsichern oder überfordern.
- Erinnern Sie an Hygienemaßnahmen. Erklären Sie diese in einfachen und kurzen Sätzen, zum Beispiel: „Bitte wasch dir vor dem Essen die Hände“. Sprechen Sie dabei zugewandt und mit freundlicher Mimik. Nutzen Sie auch Bilder.
- Halten Sie Gewohnheiten ein, zum Beispiel: Körperpflege möglichst zur gleichen Uhrzeit, Händewaschen immer vor dem Essen.
- Legen Sie Hygieneartikel gut sichtbar an festen Plätzen bereit.
- Beschriften Sie Toilettenartikel wie Becher oder Zahnbürsten, wenn die Person mit Demenz nicht allein wohnt.
- Vermitteln Sie möglichst Normalität, wenn Sie Schutzkleidung tragen müssen: Zeigen Sie sich eventuell zunächst ohne die Schutzkleidung. Beachten Sie dabei nötige Abstandsregeln. Lächeln Sie auch hinter einer Mund-Nasen-Maske, am besten etwas länger als sonst. Es kann helfen, wenn der Blick nicht direkt auf die Maske fällt. Setzen Sie sich daher schräg gegenüber.
Weitere Informationen zur Förderung körperlicher und geistiger Fähigkeiten erhalten Sie bei den Tipps zum Umgang mit Demenz.
- Fachlichen Rat einholen
-
Fachleute können über Hygienemaßnahmen informieren und bei der Umsetzung helfen. Dazu gehören Ärztinnen, Ärzte und Pflegefachpersonen. Ihren Rat einzuholen, ist besonders wichtig bei Anzeichen von Infektionen, Immunschwäche oder speziellen Problemkeimen.
- Holen Sie bei Anzeichen für eine Infektion ärztlichen Rat ein. Besprechen Sie das weitere Vorgehen. Fragen Sie konkret, worauf Sie achten sollen. Rufen Sie außerhalb der ärztlichen Sprechzeiten beim ärztlichen Bereitschaftsdienst an: 116 117. Wählen Sie im Notfall die 112, etwa bei Atemnot. Sind Sie unsicher, an wen Sie sich wenden sollten? Beim Patienten-Navi der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) werden gesundheitliche Beschwerden online abgefragt und eine Anlaufstelle vorgeschlagen.
- Fragen Sie Fachleute, ob spezielle Hygienemaßnahmen nötig sind.
- Holen Sie Rat zum richtigen hygienischen Vorgehen bei der Pflege ein. Das gilt auch für den Umgang mit Wunden, Medikamenten, einer Ernährungssonde oder einem Blasenkatheter.
- Informieren Sie sich, wie Sie mit sterilen Materialien richtig umgehen. Beispielweise gilt das für sterile Wundauflagen oder sterile Einmal-Handschuhe.
- Fragen Sie, was Sie bei multiresistenten Erregern (MRE) beachten sollten.
- Erkundigen Sie sich, welche Produkte für die jeweiligen Hygienemaßnahmen geeignet sind. Fragen Sie, wie Sie diese richtig anwenden.
- Fragen Sie bei der Pflegekasse oder privaten Pflegeversicherung der pflegebedürftigen Person, für welche Hilfsmittel die Kosten übernommen werden. Dazu gehören zum Beispiel Einmal-Handschuhe, Mund-Nasen-Masken, Desinfektionsmittel oder Bettschutzeinlagen. Informationen erhalten Sie auch bei der Verbraucherzentrale und der Beratung zur Pflege.
- Holen Sie sich fachlichen Rat, wie Sie Menschen mit Demenz bei der Hygiene unterstützen können. Informationen, Tipps und Beratung bietet zum Beispiel die Deutsche Alzheimer Gesellschaft (DAIzG).
- Nutzen Sie Pflegekurse oder Schulungen, um hygienisches Vorgehen bei der Pflege zu erlernen.
Hinweise für die professionelle Pflege
Maßnahmen zur Infektionsprävention
Stationäre Pflegeeinrichtungen und ambulante Dienste müssen Hygienevorschriften in sogenannten Hygieneplänen verbindlich festlegen. Diese dienen zum Schutz vor Infektionen bei den zu versorgenden Menschen sowie bei den Mitarbeitenden.
Rechtliche Grundlagen finden sich im Infektionsschutzgesetz (IfSG), Medizinproduktegesetz (MPG), Fünften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB V), Elften Buch des Sozialgesetzbuchs (SGB XI), in Landesheimgesetzen sowie in Landesrahmenhygieneplänen. Anforderungen ergeben sich außerdem aus Leitlinien der Fachgesellschaften und Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO). Diese empfiehlt zum Beispiel, qualifizierte Hygienebeauftragte in der stationären und ambulanten Pflege einzusetzen. Sie tragen zur Umsetzung von Hygienevorschriften bei und sind Ansprechpersonen für das Team.
Pflegeeinrichtungen und -dienste müssen zudem regelmäßige Schulungen anbieten und konkrete Verfahrensregeln festlegen. Diese betreffen beispielsweise die Händehygiene, den hygienischen Umgang mit Instrumenten und den Ablauf bei der Wundversorgung. Dazu gehören auch Regelungen zum Vorgehen bei bestimmten Infektionskrankheiten. Zudem muss die nötige Ausstattung zur Umsetzung dieser Maßnahmen bereitgestellt werden. Auch für die erforderliche Persönliche Schutzausrüstung (PSA)Persönliche Schutzausrüstung (PSA) dient dem Gesundheitsschutz von Beschäftigten. Zu PSA gehört zum Beispiel Schutzkleidung. PSA unterliegt bestimmten gesetzlichen Bestimmungen. der Mitarbeitenden muss gesorgt werden.
Des Weiteren sind sie verpflichtet, regelmäßige Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen. Dann sind Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen, Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren zu ergreifen.
Außerdem können die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt zum Gesundheitsschutz beraten. In der professionellen Pflege bieten diese auch Impfungen an.
Weitere Praxisinformationen zur Infektionsprävention in der Pflege
- Robert Koch-Institut (RKI): Studien, Empfehlungen, Merkblätter, Umgang mit dem Corona-Virus in der Pflege/Betreuung
- Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention (KRINKO): Empfehlungen
- Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW): Infektionsschutz, Hygiene, Biostoffen, PSA, Gefährdungsbeurteilung in der Pflege, Seminare
- Aktion Saubere Hände: Indikationen zur Händedesinfektion nach Pflege-Settings
- Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA): Bereitstellung und Benutzung von PSA
Gut zu wissen: Die Aktion Saubere Hände unterstützt Pflegeeinrichtungen kostenlos bei der Umsetzung von Maßnahmen zur Verbesserung der Händehygiene.